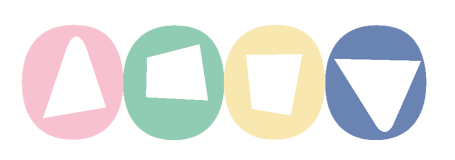Themen
Vom ICH zum DU!! Sprachentwicklung in der Kita-Praxis individuell begleiten und unterstützen
Die HANEN-Strategien des Hanen-Centre Toronto setzen gezielt an den Sprachentwicklungsstufen im Alltag an, sind praxisnah und kindzentriert. Die Wirksamkeit der Interaktions-Strategien ist wissenschaftlich bestätigt. Diese Fobi thematisiert neben der frühen sprachlichen Bildung auch Themen wie Ein- und Mehrsprachigkeit, Sprachstandserhebungen, Beratung der Eltern im Hinblick auf Entwicklung, kollegiale Fallberatung an Beispielen aus der Kita-Praxis bei möglichen Sprachentwicklungsstörungen. Der Blick auf die sinnvolle pädagogische Nutzung von digitalen Medien in Bezug auf Sprache in dieser Fobi verbinden auch noch die Themen Inklusion und kulturelle Vielfalt miteinander.
Durch die Teilnahme
- erwerben Sie Methoden zur Erkennung von individuellen Sprachentwicklungsständen der Kinder
- können Sie die vielfältigen Lebenswelten der Kinder in der täglichen Kita-Praxis im Bezug zur Sprachentwicklung wahrnehmen und wertschätzen
- können Sie gezielt die HANEN-Strategien im Alltag anwenden und den Zusammenhang von Interaktionsqualität und Sprachentwicklung reflektiert erkennen
- kennen Sie verschiedene Störungen im Spracherwerb und können Sie Eltern diesbezüglich beraten
- entwickeln sie erste Interventionen für Kinder, die Unterstützung im Spracherwerb benötigen und erkennen Sie auch Grenzen diesbezüglich
Theoretischer Input
- HANEN-Sprachkonzept Toronto
- Konzept der Alltagsintegrierten Sprachförderung
- Sprachentwicklungsstufen nach Zimmer und Tracy
- Störungsbilder nach Wendlandt
- Sprachwerkstätten
- HBEP
ICH bin anders als DU, DU bist anders als ICH... Kinder im Autismus-Spektrum verstehen lernen
Kindern, die sich "anders" verhalten, bringen uns Fachkräfte täglich im Kita-Alltag an unsere Grenzen. Besonders die Herausforderungen, die neurodiversen Denkweisen zu interpretieren, uns diesen Kindern anzunähern und sie emotional zu verstehen, verunsichert Erwachsene sowie Kinder. Unerwartete Verhaltensweisen, die im Alltag plötzlich auftreten, können sich als schwierige Situationen für die Peergroup und die pädagogischen Fachkräfte darstellen, die es gilt zu entschlüsseln, um individuelle Interventionen sinnvoll abzuleiten, um gelingende Beziehungen gestalten zu können.
Durch die Teilnahme
- erwerben Sie Grundwissen über das Autismus-Spektrum
- verstehen Sie Motive für herausforderndes Verhalten im System Kita
- lernen Sie Hintergründe und Motive autistischer Verhaltensweisen kennen und deuten
- entdecken Sie verschiedene Möglichkeiten, um mit dem Kind die individuelle Interaktion zu entwickeln
- entwickeln Sie Handlungssicherheit, um Strategien im Kita-Alltag auszuprobieren und neue Formen von Struktur- und Beziehungsgestaltung zu etablieren
- sind Sie in der Lage die Rahmenbedingungen für das Kind im Autismus-Spektrum kritisch zu reflektieren und können im Team kollegiale Beratung teilen
Theoretischer Input
- HANEN-Konzept Toronto
- Sprachentwicklungsstufen der Unterstützten Kommunikation
- Ansatz des strukturierten Vorgehens mit Symbolen und Beschäftigungen
- HBEP
Ich möchte dir doch auch etwas sagen...!! Unterstützte Kommunikation - UK in der Kita-Praxis
Verstehst du mich? Was willst du mir sagen? Verstehe ich dich richtig? Wie kann ich deine Zeichen und Gesten richtig deuten?
Für pädagogische Fachkräfte im Kita-Alltag stellten sich in vielen Momenten im Alltag die verschiedensten Fragen dazu. Wir werden diesen Fragen nachgehen und versuchen im Laufe der Fobi, Antworten für die Praxis darauf zu finden.
Kinder mit besonderem Förderbedarf sind der Fokus dieser Fobi, die zugewandte Erwachsene brauchen und sich für den Spracherwerb des „Anderen“ verantwortlich fühlen. Die multimodalen Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Kommunikation sinnvoll einsetzen, erste Gebärden und Symbole im Kita-Alltag richtig platzieren, sind von elementarer Bedeutung für die Förderung einzelner Kinder. Im Verlauf der Fortbildung schauen wir immer wieder auf individuelle Lernwege von Kindern, die sich lautsprachlich nicht oder nur schwer verständlich machen können. Diese Fobi gibt Grundwissen im Umgang mit technischen Hilfsmitteln, in der Beantragung sowie in der Bereitstellung der verschiedenen Geräte. Die pädagogische Handlungskompetenz wird durch Praxis-Werkzeug für den Kita-Alltag erweitert.
Durch die Teilnahme
- erwerben Sie Grundwissen über das Autismus- Spektrum
- verstehen Sie Motive für herausforderndes Verhalten im System Kita
- lernen Sie Hintergründe und Motive autistischer Verhaltensweisen kennen und deuten
- entdecken Sie verschiedene Möglichkeiten, um mit dem Kind die individuelle Interaktion zu entwickeln
- entwickeln Sie Handlungssicherheit, um Strategien im Kita-Alltag auszuprobieren und. neue Formen von Struktur- und Beziehungsgestaltung zu etablieren
- sind Sie in der Lage die Rahmenbedingungen für das Kind mit Autismus-Spektrum kritisch zu reflektieren und können im Team kollegiale Beratung teilen
Theoretischer Input
- HANEN-Konzept Toronto
- Sprachentwicklungsstufen nach Zimmer und Tracy
- Störungsbilder in der Sprache nach Wendlandt
- Einsatz von Gebärden und Symbolen
- HBEP
Sei doch nicht so meckrig..."Du Neunmalkluge"!
Macht und Vorurteile können sich in unserem pädagogischen Alltag einschleichen, ohne dass wir es bewusst merken. Wenn wir nach ihnen suchen, finden wir sie in der Kommunikation mit Kindern, mit den Eltern und sogar in unserem eigenen Team. Durch unsere Vorurteile diskriminieren, stigmatisieren oder grenzen wir Menschen aus. Adultismus wirkt durch das Gefälle der Macht zwischen dem Erwachsenem und dem Kind. Solche Sätze wie: „Ah typisch, die Prinzessin auf der Erbse, will heute wieder ihr Gemüse nicht essen.“ Oder: „Du Neunmalkluger, du weißt es ganz genau!!“ Aber auch ungefragt über den Kopf streichen, ist Adultismus. Das pädagogische Handeln fordert die professionelle Auseinandersetzung mit eigenen erworbenen Vorurteilen sowie in der Biografie erlebten Machtgefälle. Um im Alltag sensibel Diskriminierungen wahrzunehmen, zeigt die Inklusive Pädagogik Handlungsmöglichkeiten wie die Interaktion im Kita-Alltag weiterentwickelt werden kann.
Durch die Teilnahme
- kennen Sie ihre eigenen Erfahrungen mit Macht und Diskriminierung
- kennen Sie die verschiedenen Formen von Macht sind sie sensibilisiert in welchen Interaktionsmustern sich Adultismus versteckt
- können Sie Sozialisation und Familienkulturen als identitätsbildendes Moment erkennen
- kennen Sie entwicklungspsychologische Ursachen von Vorurteilen im menschlichen Denken und Handeln
- sind Sie sensibilisiert für diskriminierende Strukturen und Strategien im pädagogischen Alltag
Theoretischer Input
- Dimensionen Heterogenität, Adultismus, Machtstrukturen
- Sozialisation der diversen Familienkulturen
- Anti-Bias-Ansatz
- BEP-Lupen: Alltagskompetenzen, Vorurteilsbewusste Haltung
Gendersensibler Alltag in der Kita
Vielfalt der Geschlechter...
4000 geschlechtliche Differenzierungen sind in unserer Welt vorhanden. Zu glauben, es gäbe nur 2 Geschlechter wie Junge / Mädchen ist längst überholt. Stereotypen wie Junge / Mädchen begleiten unseren Alltag, denn es ist einfacher mit zwei Kategorien zurecht zu kommen. Aber werden wir so der Vielfalt gerecht? Geschlechter sind in allen Bereichen unseres Lebens verwoben. Wir finden sie in den vielen gesellschaftlichen Strukturen, die auch die Identitätsentwicklungen von Kindern beeinflussen. Obwohl wir heute kaum noch geschlechtsspezifisch erziehen, zeigen wissenschaftliche Studien, dass wir uns an traditionellen Geschlechterbilder immer wieder orientieren.
Durch die Teilnahme
- schauen Sie nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten der vielen Geschlechter diskutieren Sie Geschlechtersymboliken und Stereotypen
- erfahren Sie mögliche Impulse, die im Alltag den Erwerb der Geschlechteridentität unterstützen
- setzen Sie den Fokus auf individuelle Entfaltungsmöglichkeiten in einer genderbewussten Pädagogik
- wissen Sie, wie Sie „doing gender“ bei Kindern im Alltag begleiten, um die Konstruktionen der Geschlechtsidentität vielfältig zu prägen
Theoretischer Input
- Gendersensibles Arbeiten in der Kita nach Hubrig
- Starke Mädchen, starke Jungen nach Focks
- Dein Körper ist richtig.... nach AV 1 Pädagogik
Kummer und Trauer bei Kindern erkennen und begleiten
Kummer bei Kindern ist ihnen oft anzusehen. Aber es gibt inzwischen auch viele Kinder, die ihn nicht zeigen können. Mit uns über Worte den Kummer zu teilen, fällt im Entwicklungsalter von 0-6 Jahren besonders schwer. Sie verstehen nicht, was passiert da gerade in meinem Umfeld, was ist das in meinem Körper, wie soll ich das aushalten,wie kann ich es (mit)- teilen. Ängste, Unsicherheiten diffuse Gefühle sind Teile in den Entwicklungsphasen. Werden Kinder nicht ernst genommen und gefühlvoll begleitet,können sie nicht sicher in die nächste Stufe der Entwicklung gehen. Kinder erleben heute in ihrem sozialen Umfeld tiefgreifende Umbrüche oder gar Abbrüche durch Trennung, Scheidung, Flucht und andere Ereignisse. Konflikte in der Familie, in der Peergroup stürzen mitunter Kinder in Nöte. Sie fühlen sich allein und zudem verlassen. Welche Kenntnisse helfen uns, die sprachlichen Barrieren zu überwinden? Wie gelingt es uns, die Zeichen des Kummers zu deuten und die Kommunikation mit dem Kind anzubahnen? Welche Methoden können wir nutzen, um sprachliche Wege zum miteinander zu gestalten?
Durch die Teilnahme
- erwerben Sie Wissen zu den Themen Kummer, Trauer, Trauma
- kennen Sie kulturelle Unterschiede im Umgang mit Trauer und Kummer
- haben Sie Ihren eigenen Umgang mit Kummer und Trauer reflektiert
- kennen Sie Methoden, wie Kinder emotionale Sicherheit und Beziehung im Kita-Alltag erfahren können
- kennen Sie einige Bücher über Kinder-Kummer
- können Sie verschiedene Ausdrucksformen und körperliche Signale von Kindern deuten
- können Sie Ihre Kommunikationsform an das Kind anpassen
Theoretischer Input
- Tabuthema Trauerarbeit nach Franz
- Leuchtturm-Arbeit nach Kern
- HBEP
- BEP-Lupen: Ko-Konstruktion, Stärkung der emotionalen und sozialen Kompetenzen von Kindern, inklusive Haltung
Stark im Alltag
Im Laufe der Entwicklung geht es immer wieder um Anforderungen, die es gilt zu meistern und zu bewältigen. Insbesondere der Prozess der Anpassungsleistung an die Gegebenheiten sind Phasen, die besonders bedeutsam sind. Kinder erfahren die sich als Teil der komplexen Prozesse, die oft auch mit Umstrukturierungen gewohnter Alltagsgewohnheiten einhergehen. Die Widerstandsfähigkeit auf den verschiedensten Ebenen wird einfordert. Intensive Bindungen, in der Familie und in der Peergroup können Faktoren sein, die die Stärke herausbilden und sich als Ressource im Alltag erweisen. Auch Kinder sind jedoch von schweren Krisen betroffen, die sich durch das Leben zeichnen. Gefühle und Gedanken sind in solchen Lebenssituationen oft im Bauch gefangen und können nicht hinaus in die Welt. In diesen Momenten brauchen Kinder Fachkräfte, die sie verstehen und im Kita-Alltag stärkend zur Seite stehen.
Durch die Teilnahme
- erfahren Sie wertvolles zur Entwicklung der eigenen Resilienz
- nehmen Sie Fachwissen mit, wie sich Kummer und Trauer bei Kindern zeigen
- fördern Sie die stärkenden Kompetenzen der Kinder in schwierigen Zeiten l
- egen Sie den fachlichen Fokus auf sozio- emotionale Entwicklung bei Kindern
- kennen Sie die Meilensteine in Bezug auf Identitätsbildung
- wissen Sie Partizipation und Selbstwirksamkeit im Praxis-Alltag zu ermöglichen
Theoretischer Input
- Resilienz-Konzept nach Fröhlich-Gildhoff
- Bindung und menschliche Entwicklung nach Grossmann
- HBEP-Lupen
Inklusionsanträge, aber wie?
Im Kita-Alltag die ICF-CY anwenden
Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Mit Einführung der ICF hat die Weltgesundheitsorganisation eine Grundlage geschaffen, damit sowohl Leistungsträger als auch Leistungserbringer eine einheitliche Sprache sprechen.
Die UNO-Kinderrechtskonvention von 1989 besagt im Artikel 23 (1) „Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig und körperlich behindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren, seine Selbstständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern“.
Die Entwicklung der Kinder ist stets ein dynamischer Prozess, der vom Säuglingsalter bis ins Jugendalter von physischer, psychischer und sozialer Reifung geprägt ist. Die Kinder verbringen auf dem Weg ihrer Entwicklung viel Zeit in der Kita. Das erfordert besondere Aufmerksamkeit, Fachwissen und interdisziplinärer Austausch im Team, mit Eltern und mit den Kindern selbst.
Durch die Teilnahme
- erhalten Sie einen ersten Überblick über die Bedeutung und die Arbeitsweise der ICF_CY
- schauen Sie immer wieder auf individuelle Entwicklungswege der Kinder
- orientieren Sie sich dabei an den vier Schlüsselthemen der ICF-CY
- probieren Sie erste Codierungen anzuwenden
- entwickeln Sie erste Umsetzungsideen der ICF-CY für den Kita-Alltag
Theoretischer Input
- ICF-CY Klassifizierung
- Heilpädagogische Interventionen
- Förderplanung
Spielen, spielen und nochmals spielen...
Spielen gilt als Königsdisziplin der Entwicklung. Alle Kinder probieren aus, entdecken sich und andere dabei. Sie sind frei, ungezwungen und handeln intrinsisch motiviert. Sie eignen sich im Spiel handelnd die Welt an. Im Spiel zeigt ein Kind, in welcher Entwicklungsphase es sich gerade befindet und welche Themen es besonders spannend findet. Lernen gelingt genau da, wenn wir begreifen, dass wir Kinder auf ihrem Weg begleiten und ihrem zweckfreien Tun Raum und Zeit geben sollten. Das Gefühl und das lustvolle Eintauchen in eine andere Welt werden als zentraler Aspekt in der Selbstbildung eines Kindes betrachtet. Es bildet sich selbst und kann durch gezielte Räume, Materialien und Erwachsene aktiv die Welt entdecken und weiterentwickeln.
Durch die Teilnahme
- kennen Sie verschiedene Spielformen und Entwicklungsphasen
- erfahren Sie die Bedeutung des Spiels und können Sie es pädagogisch fachlich kommunizieren
- sind Sie sensibel, um Spielelemente zu beobachten und weiterzuführen können Sie eigene Handpuppen bauen
- erhalten Sie eine Einführung ins eigene kreative darstellende Spiel
Theoretischer Input
- Theorie des Spielens nach Franz
- Imaginationen -einfach gemacht
- HBEP Lupen
QSV* Qualifizierte Vorschulvorbereitung Hessen
„Alle Kinder erwerben die sprachlichen Kompetenzen am erfolgreichsten im positiven sozialen Kontakt mit Personen, die ihnen wichtig sind, bei Themen, die ihre eigenen Interessen berühren, im Zusammenhang mit Handlungen, die für sie selbst Sinn ergeben." (HBEP.66) Kinder lernen besonders in partizipativ angelegten Lernräumen und Projekten sich vom Gegenständlichen zu lösen: sie erzählen, planen, philosophieren, handeln aus, argumentieren, begründen und lernen in ihrem eigenen Tempo.
Es gibt viele Gelegenheiten, die wir in der Qualifizierten Schulvorbereitung ergreifen können, damit sich Kinder als autonomes soziales Wesen, selbstwirksam erleben und vorbereitet sind auf eher kognitiv strukturierte Lernprozesse in der Schule. Gestalten wir Fachkräfte, die Bildungsprozesse als partizipativen, ko-konstruktiven Bildungsprozess, der an den Themen und Interessen der Kinder ansetzt und einen hohen Alltags- und Lebensbezug aufweist, dann können Kinder die verschiedenen Kompetenzen der Kinder gestärkt werden.
Durch die Teilnahme
- lernen Sie Interessen und Themen der Kinder in anregender Projektarbeit zu verfolgen
- setzen Sie sich mit Merkmalen und Prinzipien kreativer Projektarbeit auseinander
- können Sie Lern- und Entwicklungsprozesse sowohl der Projektgruppe als auch der einzelnen Kinder in den Blick nehmen
- erkunden Sie, wie bildungssprachliche Fähigkeiten angebahnt werden und im Rahmen der QSV umgesetzt werden können
Theoretischer Input
- Qualifizierte Schulvorbereitung (QSV) - Erfolgreiche Bildungspraxis in Kindertageseinrichtungen
- Eine Handreichung zum Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren
- Erfolgreiches Gestalten des Überganges von der Kindertagesstätte in die Grundschule
- Bildungs- und Erziehungsempfehlung Rheinland -Pfalz Situationsansatz nach Krenz
- Starke Mädchen, Starke Jungen nach Focks
- Entwicklungspsychologische Grundlagen nach Hauk-Schnabel
- BEP-Lupen: Ko-Konstruktion, Stärkung der emotionalen und sozialen Kompetenzen von Kindern, inklusive Haltung
info@fobi-praxis.de
© 2023 Kathleen Nube-Abd Elhafiz. Erstellt mit IONOS SE
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.